


Die Informationstechnologie (IT) bringt regelmäßig disruptive Innovationen hervor, die unser aller Leben maßgeblich verändern. Zugleich ist der IT-Bereich durch einen starken Wettbewerb geprägt. Erfolgreiche Funktionen landen schnell in der Software der Konkurrenz – es sei denn, sie genießen einen effektiven Schutz.
Mögliche Schutzinstrumente für Ihre computer-implementierten Entwicklungen sind das Patent für Software und KI, der Urheberrechtsschutz und das Design. Allerdings nimmt Software und KI im Patentrecht eine Sonderstellung ein; ihre Patentierung ist in Europa mit besonderen Anforderungen verbunden. Ob und wie Software durch ein Patent oder Design wirksam vor Nachahmung geschützt werden kann, bedarf deshalb intensiver Prüfung durch spezialisierte Anwälte, die alle rechtlichen Möglichkeiten kennen und im Sinne des Erfinders ausschöpfen.

Grundsätzlich ist auch Software dem Patentschutz zugänglich. Um für die sogenannten Computer-implementierten Erfindungen (CII) ein Patent zu erlangen, ist es in Deutschland und Europa notwendig, zu zeigen, welchen technischen Beitrag die Software leistet. Damit soll u.a. verhindert werden, dass allgemeine Algorithmen, Geschäftsmethoden und sonstige administrative bzw. reine gedankliche Tätigkeiten durch Patente monopolisiert werden.
Welche Aspekte einer Erfindung „technisch“ im Sinne des Patentrechts sind, ist immer eine Einzelfallprüfung und sollte in Zusammenarbeit mit einem in diesem Gebiet erfahrenen Patentanwalt geprüft werden.
Beispiele für technische und somit prinzipiell durch ein Patent schützbare Software sind:
Erfindungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) lassen sich ebenfalls schützen, sofern sie einen technischen Bezug aufweisen. Die Herausforderung besteht darin, dass KI-Erfindungen häufig eine Anwendung in technischen und nicht-technischen Bereichen zulassen und viele mathematische oder algorithmische Aspekte aufweisen.
Künstliche Intelligenz lässt sich vereinfacht gesagt dann patentieren, wenn die Erfindung den abstrakt-gedanklichen Bereich verlässt und der Lösung eines technischen Problems in einem technischen Feld dient.
Beispielsweise kann eine KI-Erfindung durch ein Patent abgesichert werden, wenn sie die Ausführung von Programmen auf einem Computer verbessert, indem weniger Speicher oder weniger Rechenressourcen benötigt werden. Möglich ist es auch, ein Patent auf die innovative Erzeugung von Trainingsdaten für KI-Systeme zu erhalten.
Ob bei einer KI-Entwicklung eine Anmeldung zum Patent möglich und sinnvoll ist, ist im Einzelfall zu entscheiden. Unsere erfahrenen Patentanwälte für den Bereich KI unterstützen Sie gerne dabei, dies zu prüfen.
Der Unterschied liegt meist in der Art der technischen Aufgabe:
Während Softwarepatente oft Verfahren und Strukturen abdecken, die Daten verarbeiten oder Maschinen steuern, kann bei KI der Fokus auf innovativen Trainingsmethoden, Modellen oder automatisierten Entscheidungswegen liegen, die technisches Neuland betreten. Bei KI-Erfindungen können zum Beispiel eine effiziente Lern- und Entscheidungsstruktur, Datenvorfilterung und Datenzugriff zu einem erfinderischen technischen Effekt führen.
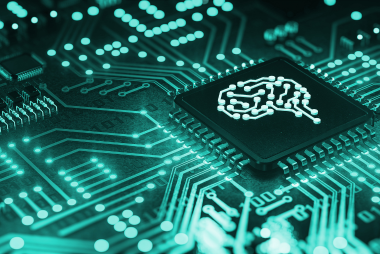
Unternehmen mit einem starken Patentportfolio gelten als besonders innovativ. Vordringlich geht es beim Patentschutz darum, dass Patentinhaber es ihren Wettbewerbern verbieten können, die patentierte Erfindung zu nutzen.
Patente sichern somit Alleinstellungsmerkmale ab, die sich sogar in barer Münze auszahlen können: Studien zeigen, dass kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) mit entsprechenden Patenten pro Mitarbeiter 68 % höhere Einnahmen verzeichnen als vergleichbare KMU, die ihre Innovationen nicht absichern (springerprofessional.de).
Der Urheber eines Werkes erhält Schutz vor Nachahmung. Im Bereich Software wird meist der Programmcode als durch das Urheberrecht geschützt angesehen. Folglich erwirbt sich der Programmierer bereits durch das Erstellen des Programmcodes den entsprechenden Schutz darauf.
Der Schutz auf den Programmcode beschränkt sich allerdings auf die konkrete Implementierung, das heißt auf die in einer bestimmten Programmiersprache umgesetzte Lösung. Damit bietet das Urheberrecht für Software keinen effektiven Schutz vor Nachahmungen.
Mit einem Patent hingegen ist es möglich, Schutz für das hinter einer konkreten Implementierung liegende Konzept zu erlangen: die eigentliche Erfindung. Der Schutz durch ein Patent reicht somit deutlich weiter und bietet einen effektiveren Schutz, beispielsweise gegen das Nachprogrammieren eines Algorithmus.
Die Frage, ob ein trainiertes Modell, beispielsweise ein trainiertes Large Language Model, Urheberrechtsschutz genießt, kann nicht abschließend beantwortet werden. Diese Rechtsfrage wird in vielen Ländern sehr lebhaft diskutiert. Während die Frage danach, ob ein Training eine Urheberrechtsverletzung darstellen kann, langsam geklärt wird, bleibt die Frage nach dem Urheberrechtsschutz für das trainierte Modell zumindest in Deutschland weiterhin ungeklärt. Eine oft vertretene Meinung ist, dass beim Trainieren keine persönliche geistige Schöpfung entsteht. Den Autor dieses Textes kann diese Auffassung jedoch nicht überzeugen, da auch wenn das Training am Ende die Leistung einer Maschine ist, im Vorfeld zahlreiche menschliche Überlegungen und Auswahlentscheidungen stehen.
Neben der Technik ist ein Großteil der Innovationen im IT-Bereich auf eine bessere und einfachere Bedienung zurückzuführen. Ein Beispiel ist die grafische Benutzeroberfläche (GUI).
Für ästhetische Aspekte gibt es das Designrecht, mit dem kosteneffizient GUIs EU-weit geschützt werden können.
Darüber hinaus ist es in bestimmten Fällen möglich, Patentschutz auf die Bedienung einer Maschine zu erhalten – wenn sie zu physischen bzw. technischen Effekten führt. Ein prominentes Beispiel ist das bekannte „rubber-band“ Verhalten beim Scrollen von Listen bei einem Mobiltelefon.
Der erste Schritt zum Erlangen von Patentschutz ist die Einreichung einer Patentanmeldung. Gerade bei Software- und KI-Patenten ist Vorsicht geboten: Die technischen Beiträge müssen präzise herausgearbeitet werden, und internationale Unterschiede sind früh zu berücksichtigen.
Wird die Anmeldung unsauber vorbereitet, können wichtige Schutzpositionen verloren gehen. Deshalb sollte die Patentanmeldung immer von spezialisierten Patentanwälten begleitet werden.
KI-Tools helfen auch bei der Verbesserung von Patentanmeldungen, der Bearbeitung von Prüfungsbescheiden und von Einsprüchen. Sie dienen nicht nur als Hilfe bei Patenrecherchen, sondern können mit professionellem Prompting auch bei der Analyse unterstützen.
Ein innovativer Ansatz ist die Kombination von KI mit der Theorie des erfinderischen Problemlösens TRIZ, die auf der systematischen Auswertung von Patentliteratur beruht. Diese TRIZ-Methode lässt sich mit KI-Tools nutzen, um technische Probleme auf neue und innovative Weise zu lösen. Dabei unterstützt TRIZ bei der Erstellung von Prompts, die mit gängigen Large-Language-Modellen zu Vorschlägen zur Lösung von technischen Problemen führen.
Damit lässt sich auch die Erstellung von Patentanmeldungen optimieren, indem die entworfenen Patentansprüche auf Umgehungsmöglichkeiten überprüft werden.
Diese KI-Methodik kann auch dazu genutzt werden, den Schutzbereich erteilter Patente zu untersuchen und technische Vorschläge für Umgehungsvarianten zu entwickeln.
Bei Meissner Bolte steht ein spezialisiertes Team von Rechtsanwälten und Patentanwälten bereit, um Software- und KI-Erfindungen zu schützen. Als eine der wenigen Kanzleien in Deutschland verfügen wir über ein Software- und KI-Team mit diplomierten Informatikern, die alle Verfahren in diesem Bereich effektiv betreuen. Unsere Expertise umfasst:
Darüber hinaus verfügen wir über ein internationales Netzwerk exzellenter Partnerkanzleien, um Mandanten weltweit bestmöglich zu begleiten. Wenn Sie an der Anmeldung einer Erfindung im Bereich Software oder KI interessiert sind, stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung. Wir verfügen auch über Tools, Expertise und Kooperationspartner, um Sie mit KI und TRIZ zu unterstützen.


